|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
Michelfeld (Gemeinde Angelbachtal,
Rhein-Neckar-Kreis)
Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Michelfeld bestand eine jüdische Gemeinde bis 1935. Ihre Entstehung geht in
die Zeit des 16./18. Jahrhunderts zurück (erste Nennungen 1548, dann wieder
seit 1721).
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1807 125 jüdische Einwohner, 1825 172 (15,3 % von insgesamt 1.126
Einwohnern), höchste Zahl um 1839 mit 242 Personen, 1871 167, 1875 144
(11,0 % von insgesamt 1.304), 1887 134, 1900 54 (3,8 % von 1.433), 1910 22 (1,6
% von 1.417).
Die jüdischen Gemeinden verdienten ihren Lebensunterhalt durch Handel mit Vieh,
Landesprodukten und Textilien. Auch trugen sie zur Industrialisierung des Ortes
bei: 1808 errichtete Zacharias Oppenheimer eine Wolltuchfabrik (später:
Wolltuchfabrik Gebr. Oppenheimer). 1814 folgte eine mechanische Spinnerei und
Walkerei. Die Fabrik beschäftigte 60-70 Personen. Auf der 5.
Landesindustrieausstellung in Karlsruhe 1861 erhielt sie eine silberne Medaille
für gute Tuche, die sich durch feine Wolle und schöne Appretur auszeichnete.
Anmerkung: an die Wolltuchfabrik der Gebr. Oppenheimer erinnert bis heute die
Fabrikstraße (Fabrikgebäude in der Fabrikstraße 7)
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine
jüdische Schule (Israelitische Volksschule / Elementarschule bis 1876, danach
Religionsschule; die Schule war im Synagogengebäude), ein rituelles Bad sowie
seit 1868 einen eigenen Friedhof. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der
Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und
Schochet tätig war. In besonderer Erinnerung blieb der Hauptlehrer Münzesheimer,
der seit 1830 in der Gemeinde tätig war und 1870 hier sein 40-jähriges
Ortsjubiläum feiern konnte (siehe unten). In den 1870er-Jahren war Adolf Weil
Lehrer in Michelfeld (siehe unten Bericht zu einer Trauerfeier 1877). 1904 wurde die Lehrerstelle gemeinsam
für Michelfeld und Eichtersheim
ausgeschrieben (siehe unten). 1827 wurde die Gemeinde dem Rabbinatsbezirk Bruchsal
zugeteilt.
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Julius Lang (geb.
7.2.1897 in Michelfeld, gef. 21.10.1917). Sein Name steht auf dem
Gefallenendenkmal bei der evangelischen Kirche. Außerdem ist gefallen:
Gefreiter Hugo Scheuer (geb. 3.7.1892 in Michelfeld, vor 1914 in Bruchsal
wohnhaft, gef. 20.9.1917).
Um 1924, als zur Gemeinde noch 12 Personen gehörten (0,85 % von
insgesamt etwa 1.400 Einwohnern), war Gemeindevorsteher Max Lang. Der
Religionsunterricht der Kinder der Gemeinde durch wurde Lehrer Jakob Lewin aus
Malsch erteilt. Auch 1932 wird als Gemeindevorsteher Max Lang genannt
(damalige Adresse: Karlstraße 13).
An ehemaligen, bis nach 1933 bestehenden Handelsbetrieben in jüdischem
Besitz sind bekannt: Krämerladen Hannchen Lang (Karlstraße 15),
Landesproduktenhandlung Familie Strauß (Schallbachgasse 3).
1935 lebten noch die beiden Familien Lang und Strauß am Ort, die die
genannten Handelsbetriebe innehatten. Nach der Auflösung der Gemeinde am 18.
November 1935 wurden die hier noch lebenden Juden der Gemeinde Eichtersheim
zugeteilt.
Nach den Deportationen in der NS-Zeit kam von den 1933 hier wohnhaften fünf
jüdischen Einwohnern mindestens eine Person ums Leben.
Von den in Michelfeld geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen
Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Karoline Blum geb. Zimmern
(1860), Therese Groß (1896), Anna Jenny Haas
geb. Kayem (1892), Rosa Kander geb. Menges (1883), Max Lang (1862), Moritz Mayer
(1881), Klara Sommer geb. Scheuer (1877), Max Strauss (1900), Lina Wertheimer
geb. Zimmern (1871).
Hinweis: es kommt in einigen Listen zu Verwechslungen von Michelfeld
(Gemeinde Angelbachtal) mit Michelfeld (Stadt/Lkr. Auerbach in der Oberpfalz):
so lebten die jüdischen Frauen Emma Wilmersdörfer geb. Fleischmann (geb. 1883 in
Altenmuhr), Rosa Dahlheimer geb. Solinger
(geb. 1895 in Aschaffenburg) und Therese Groß
(geb. 1896 in Nürnberg) wie auch Emma
Kirschbaum (geb. 1883 in Marktbreit) vor
ihrer Ermordung in der NS-Zeit einige Zeit in einer Einrichtung in Michelfeld
(Oberpfalz) im damaligen "Versorgungshaus für weibliche Geistesschwache und
Gebrechliche" (bis 1934/35 Taubstummenanstalt bzw. Versorgungsanstalt für
(schulentlassene) taubstumme Mädchen und Frauen). Die Frauen wurden am 14. September
1940 in die Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar verlegt und von dort am 20.
September 1940 in die Tötungsanstalt Hartheim. Vgl. die Informationen in der
Seite zu Michelfeld (Oberpfalz):
https://regens-wagner-michelfeld.de/ueber-regens-wagner/erinnerungs-orte/,
speziell zu Emma Wilmersdörfer:
https://regens-wagner-michelfeld.de/ueber-regens-wagner/erinnerungs-orte/aktion-t4-emma/
Berichte aus
der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Lehrers, Vorsängers und
Schochet (1884 / 1893 / 1900 / 1904)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. März 1884:
"Die mit freier Wohnung, einem festen Gehalte von 600 Mark, mit den
üblichen Nebeneinnahmen verbundene Stelle eines Kantors und
Schächters in der Gemeinde Michelfeld soll baldigst besetzt
werden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. März 1884:
"Die mit freier Wohnung, einem festen Gehalte von 600 Mark, mit den
üblichen Nebeneinnahmen verbundene Stelle eines Kantors und
Schächters in der Gemeinde Michelfeld soll baldigst besetzt
werden.
Mit den nötigen Zeugnissen versehene Bewerbungen sind an den
Unterzeichneten zu richten. Bruchsal, den 10. März 1884. Die
Bezirks-Synagoge. Dr. J. Eschelbacher." |
| |
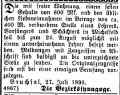 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Juli 1893:
"Die mit freier Wohnung, einem festen Gehalte von 600 Mark und den
üblichen Nebeneinnahmen im Betrage von ca. 400 Mark verbundene Stelle
eines Lehrers, Vorsängers und Schächters in Michelfeld soll bis zum 24.
August möglichst mit einem unverheirateten Lehrer besetzt werden.
Meldungen mit Zeugnissen in Abschrift sind baldigst an die unterzeichnete Stelle
zu senden. Die Originalzeugnisse sind erst bei einer etwaigen Berufung
vorzulegen. Bruchsal, 27. Juli 1893. Die Bezirkssynagoge." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Juli 1893:
"Die mit freier Wohnung, einem festen Gehalte von 600 Mark und den
üblichen Nebeneinnahmen im Betrage von ca. 400 Mark verbundene Stelle
eines Lehrers, Vorsängers und Schächters in Michelfeld soll bis zum 24.
August möglichst mit einem unverheirateten Lehrer besetzt werden.
Meldungen mit Zeugnissen in Abschrift sind baldigst an die unterzeichnete Stelle
zu senden. Die Originalzeugnisse sind erst bei einer etwaigen Berufung
vorzulegen. Bruchsal, 27. Juli 1893. Die Bezirkssynagoge." |
|
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1900:
"Die Religionsschulstelle Michelfeld ist zu besetzen. Fixum
700 Mark, Nebengefälle für Schächten etwa 400 Mark, freie Wohnung und
40 Mark Aversum für Brennmaterial. Bewerbungen an die Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1900:
"Die Religionsschulstelle Michelfeld ist zu besetzen. Fixum
700 Mark, Nebengefälle für Schächten etwa 400 Mark, freie Wohnung und
40 Mark Aversum für Brennmaterial. Bewerbungen an die
Bezirkssynagoge Bruchsal: Dr. Doctor." |
| |
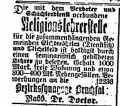 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. März 1904: "Die
mit dem Vorbeter- und Schächterdienst verbundene Religionslehrerstelle
für die zusammenhängenden Gemeinden Eichtersheim
(Dienstsitz) und Michelfeld ist baldigst durch einen seminaristisch
gebildeten Lehrer zu besetzen. Gehalt 1.000 Mark, freie Wohnung und etwa
300-400 Mark Nebengefällen. Bewerbungen an die Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. März 1904: "Die
mit dem Vorbeter- und Schächterdienst verbundene Religionslehrerstelle
für die zusammenhängenden Gemeinden Eichtersheim
(Dienstsitz) und Michelfeld ist baldigst durch einen seminaristisch
gebildeten Lehrer zu besetzen. Gehalt 1.000 Mark, freie Wohnung und etwa
300-400 Mark Nebengefällen. Bewerbungen an die
Bezirkssynagoge Bruchsal:
Rabbiner Dr. Doctor." |
40-jähriges Dienstjubiläum von Hauptlehrer
Münzesheimer (1870)
Hauptlehrer Münzesheimer war im 19. Jahrhundert über vier
Jahrzehnte wichtigste Persönlichkeit der jüdischen Gemeinde. Um 1850 besaß er
9 Viertel eigenen Ackers. Zur Bewirtschaftung zog er die Schüler der oberen
Klassen an den beiden schulfreien "halben Spieltagen" heran.
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 31. Mai 1870:
"Michelfeld, 7. Mai (1870). (Baden). Gestern wurde das
40-jährige Dienstjubiläum unseres verehrten israelitischen Hauptlehrers Münzesheimer,
welcher seit 6. Mai 1830 an der hiesigen israelitischen Volksschule mit
allseitig anerkannter Berufstreue wirkt, festlich begangen. Hierbei wurde
dem Jubilar nach einer Ansprache des hiesigen Pfarrers Becker ein von
früheren Schülern gestiftetes Kapitel von 681 Gulden übergeben,
worunter Beiträge aus den fernsten Gegenden (New York, San Francisco
etc.). Im schön geschmückten Saale des Gasthauses zum Adler vereinigten
sich die Festteilnehmer, gegen 70 an der Zahl und allen Ständen und
Bekenntnissen angehörend, zu frohem Beisammensein bei Musik und Gesang
bis zum Abende." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 31. Mai 1870:
"Michelfeld, 7. Mai (1870). (Baden). Gestern wurde das
40-jährige Dienstjubiläum unseres verehrten israelitischen Hauptlehrers Münzesheimer,
welcher seit 6. Mai 1830 an der hiesigen israelitischen Volksschule mit
allseitig anerkannter Berufstreue wirkt, festlich begangen. Hierbei wurde
dem Jubilar nach einer Ansprache des hiesigen Pfarrers Becker ein von
früheren Schülern gestiftetes Kapitel von 681 Gulden übergeben,
worunter Beiträge aus den fernsten Gegenden (New York, San Francisco
etc.). Im schön geschmückten Saale des Gasthauses zum Adler vereinigten
sich die Festteilnehmer, gegen 70 an der Zahl und allen Ständen und
Bekenntnissen angehörend, zu frohem Beisammensein bei Musik und Gesang
bis zum Abende." |
Zum Tod von Lehrer Adolf Weil in
Eichstetten (1929; war in den
1870er-Jahren Lehrer in Michelfeld)
 Artikel
in "Israelitisches Familienblatt" vom 28. März 1929: "Freiburg im
Breisgau (Oberlehrer Adolf Weil). Am vergangenen Freitag wurde ein
verdienter Veteranen des Lehrerstandes, Oberlehrer Adolf Weil, wenige
Tage vor seinem 82. Geburtstage zu Grabe getragen. 36 Jahre wirkte der
Heimgegangene als Hauptlehrer an der Simultanschule in
Eichstetten, wo ihm schon vor einer
Reihe von Jahren von der Oberschulbehörde das Amt des Oberlehrers und
Schulleiters übertragen worden war. Früher war er an der Volksschule in
Reilingen,
Sandhausen und Michelfeld
tätig. Ein kenntnisreicher, vielseitig gebildeter Mann von vorbildlicher
Pflichttreue und hervorragende Eignung für sein verantwortungsvolles Lehrer-
und Erzieheramt, hat mit ihm das Zeitliche gesegnet. Seine segensreiche
Wirksamkeit ist von der Regierung durch die Verleihung des Verdienstkreuzes
vom Zähringer Löwen anerkannt worden. Die zahlreiche Beteiligung an seiner
Bestattung, bei der der Synagogenrat und die Ortsbehörde von
Eichstetten und zahlreiche seiner
Kollegen von Stadt und Land zugegen waren, sowie die Nachrufe am Grabe - es
sprach Religionslehrer Strauß für die Bezirkskonferenz und den Natalie
Eppstein-Verein, Oberlehrer Gänshirt für die Schulbehörde in
Eichstetten, Herr Heinrich Mayer -
Freiburg für den Reichsbund jüdischer
Frontsoldaten - legten Zeugnis ab von der allgemeinen Wertschätzung, der er
sich erfreuen durfte. Der Landwehr- und Reservistenverein, dem der
Verstorbene als Schriftführer angehörte, legte einen Kranz nieder. Der
Oberrat der Israeliten, die Bezirkssynagoge und der Synagogenrat Eichstetten
ließen durch den Mund des Herrn Bezirksrabbiners dem verdienstvollen
Religionslehrer Dank und Anerkennung aussprechen. Herr Bezirksrabbiner
Dr. Zimels zeichnete in seinem warm empfundenen Nachruf die
Lehrertugenden, welche den Entschlafenen in hohem Maße auszeichneten. Auch
im Ruhestand hat der bis zuletzt körperlich und geistig ungewöhnlich rüstige
Mann in Freiburg, dass er sich zu seinem alten Sitze ausersehen hatte, seine
Unterrichtstätigkeit fortgesetzt wie er sich auch auf sonstigen Gebieten: im
jüdischen Jugendbund, für den Naphtali Epstein-Verein und den
Landeswaisenverein mit Eifer und Erfolg betätigte." Artikel
in "Israelitisches Familienblatt" vom 28. März 1929: "Freiburg im
Breisgau (Oberlehrer Adolf Weil). Am vergangenen Freitag wurde ein
verdienter Veteranen des Lehrerstandes, Oberlehrer Adolf Weil, wenige
Tage vor seinem 82. Geburtstage zu Grabe getragen. 36 Jahre wirkte der
Heimgegangene als Hauptlehrer an der Simultanschule in
Eichstetten, wo ihm schon vor einer
Reihe von Jahren von der Oberschulbehörde das Amt des Oberlehrers und
Schulleiters übertragen worden war. Früher war er an der Volksschule in
Reilingen,
Sandhausen und Michelfeld
tätig. Ein kenntnisreicher, vielseitig gebildeter Mann von vorbildlicher
Pflichttreue und hervorragende Eignung für sein verantwortungsvolles Lehrer-
und Erzieheramt, hat mit ihm das Zeitliche gesegnet. Seine segensreiche
Wirksamkeit ist von der Regierung durch die Verleihung des Verdienstkreuzes
vom Zähringer Löwen anerkannt worden. Die zahlreiche Beteiligung an seiner
Bestattung, bei der der Synagogenrat und die Ortsbehörde von
Eichstetten und zahlreiche seiner
Kollegen von Stadt und Land zugegen waren, sowie die Nachrufe am Grabe - es
sprach Religionslehrer Strauß für die Bezirkskonferenz und den Natalie
Eppstein-Verein, Oberlehrer Gänshirt für die Schulbehörde in
Eichstetten, Herr Heinrich Mayer -
Freiburg für den Reichsbund jüdischer
Frontsoldaten - legten Zeugnis ab von der allgemeinen Wertschätzung, der er
sich erfreuen durfte. Der Landwehr- und Reservistenverein, dem der
Verstorbene als Schriftführer angehörte, legte einen Kranz nieder. Der
Oberrat der Israeliten, die Bezirkssynagoge und der Synagogenrat Eichstetten
ließen durch den Mund des Herrn Bezirksrabbiners dem verdienstvollen
Religionslehrer Dank und Anerkennung aussprechen. Herr Bezirksrabbiner
Dr. Zimels zeichnete in seinem warm empfundenen Nachruf die
Lehrertugenden, welche den Entschlafenen in hohem Maße auszeichneten. Auch
im Ruhestand hat der bis zuletzt körperlich und geistig ungewöhnlich rüstige
Mann in Freiburg, dass er sich zu seinem alten Sitze ausersehen hatte, seine
Unterrichtstätigkeit fortgesetzt wie er sich auch auf sonstigen Gebieten: im
jüdischen Jugendbund, für den Naphtali Epstein-Verein und den
Landeswaisenverein mit Eifer und Erfolg betätigte." |
Hauptlehrer Adolf Weil spricht bei einer Beisetzung im Friedhof in Wiesloch (1877)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Oktober 1877: "Wiesloch,
20. September (1877). Am Tag nach Jom Kippur ereignete sich in dem
eine Stunde von hier entfernten Dorf Mühlhausen ein sehr bedauernswerter
Fall. Der allgemein geachtete und beliebte Bürger Heinrich Wahl von
Sandhausen, Amts Heidelberg, ging Morgens 6 Uhr wohl und munter von seiner
Familie nach Mühlhausen, um Hopfen einzukaufen, kam auf einen Speicher,
der in Verbindung mit der Scheune steht, um Muster zu sehen; kaum dort,
tat er einen Fehltritt und stürzte 25 Fuß hoch so unglücklich herunter,
dass er sofort bewusstlos weggetragen werden musste und trotz aller
ärztlichen Hilfe, nachts 12 Uhr, seinen Leiden erlag. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Oktober 1877: "Wiesloch,
20. September (1877). Am Tag nach Jom Kippur ereignete sich in dem
eine Stunde von hier entfernten Dorf Mühlhausen ein sehr bedauernswerter
Fall. Der allgemein geachtete und beliebte Bürger Heinrich Wahl von
Sandhausen, Amts Heidelberg, ging Morgens 6 Uhr wohl und munter von seiner
Familie nach Mühlhausen, um Hopfen einzukaufen, kam auf einen Speicher,
der in Verbindung mit der Scheune steht, um Muster zu sehen; kaum dort,
tat er einen Fehltritt und stürzte 25 Fuß hoch so unglücklich herunter,
dass er sofort bewusstlos weggetragen werden musste und trotz aller
ärztlichen Hilfe, nachts 12 Uhr, seinen Leiden erlag.
Heute nun bewegte sich ein unübersehbarer Leichenzug durch hiesige Stadt
um die irdischen Überreste des Verewigten auf den hiesigen Friedhof
(Wiesloch) zu verbringen. Von Nah und Fern kamen Leute herbei, besonders
viele Christen, darunter der ganze Gemeinderat von Sandhausen, um dem
Verblichenen die letzte Ehre zu erweisen. Eine große Beteiligung an der Beisetzung
fand schon in Mühlhausen statt, und ist hier das Zeugnis für den
Verstorbenen abgelegt worden, mit welcher Anhänglichkeit die Bauern an
dem Verstorbenen hingen, wegen seines aufrichtigen Handelns. Herr
Hauptlehrer Weil aus Michelfeld gedachte in schönen Worten des
Unglücklichen.
Der zur Beisetzung hierher berufene Bezirksrabbiner Dr. Sondheimer
aus Heidelberg sprach am Grabe über die Worte Jeremia 14, Vers 17. Er war
sichtlich gerührt und entwarf in sehr ergreifenden Worten ein kurzes
Lebensbild des Verstorbenen und seines Wirkens, sodass kein Auge
tränenleer blieb.
Der Unglückliche erreichte ein Alter von 44 Jahren, war
Synagogenratsvorstand, auch war er aushilfsweise an den ehrfurchtgebietenden
Tagen schon seit mehreren Jahren ehrenamtlicher Vorbeter. Er
hinterlässt eine tief trauernde Witwe mit 6 noch kleinen, unmündigen
Kindern.
Möge der Allgütige, der da ist der Vater der Waisen und der Witwen
der schwer heimgesuchten Gattin und den lieben Kleinen seinen himmlischen
Trost senden, damit sie den Willen Gottes hoch achten und das Andenken des
Verblichenen ehren. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens. Ackermann,
Lehrer." |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Die Auflösung der Gemeinde Ende
1935
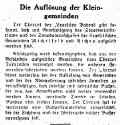 Artikel
in der Zeitschrift des Central-Vereins ("CV-Zeitung" vom 9.
Januar 1936: "Die Auflösung der Kleingemeinden. Der Oberrat
der Israeliten Badens gibt bekannt, dass mit Genehmigung des
Staatsministeriums und des Synodalausschusses die israelitischen Gemeinden
Michelfeld und Richen aufgelöst
worden sind. Artikel
in der Zeitschrift des Central-Vereins ("CV-Zeitung" vom 9.
Januar 1936: "Die Auflösung der Kleingemeinden. Der Oberrat
der Israeliten Badens gibt bekannt, dass mit Genehmigung des
Staatsministeriums und des Synodalausschusses die israelitischen Gemeinden
Michelfeld und Richen aufgelöst
worden sind.
Gleichzeitig wird bekannt gegeben, dass aus den Beständen aufgelöster
Gemeinden vom Oberrat Torarollen verwahrt werden, die anderen Gemeinden
überlassen werden können. Der Oberrat bittet weiterhin bei der
Auflösung von Gemeinden und bei der Abwanderung jüdischer Familien zu
berücksichtigen, dass jüdische und hebräische Bücher, die von den
Betreffenden nicht weiter verwendet werden können, wertvolle Dienste in
Schulen, Bünden usw. leisten können. Der Oberrat hat in Karlsruhe eine
Büchersammelstelle eingerichtet, die die Sichtung und die Weitergabe
solcher Bücher vornehmen soll." |
| |
 Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 8. Januar 1936:
"Zwei jüdische Kleingemeinden in Baden aufgelöst. Karlsruhe.
Der Oberrat der Israeliten Badens gibt bekannt, dass mit Genehmigung des
Staatsministeriums und des Synodalausschusses die israelitischen Gemeinden
Michelfeld und Richen aufgelöst
worden sind."
Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 8. Januar 1936:
"Zwei jüdische Kleingemeinden in Baden aufgelöst. Karlsruhe.
Der Oberrat der Israeliten Badens gibt bekannt, dass mit Genehmigung des
Staatsministeriums und des Synodalausschusses die israelitischen Gemeinden
Michelfeld und Richen aufgelöst
worden sind." |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der Gemeinde
"Mundtoterklärung" von Bräunle Hochstätter
(1844)
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 27. April 1844 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Wiesloch.
[Mundtoterklärung]. Bräunle Hochstätter, Tochter des
verstorbenen Baruch Hochstätter zu Michelfeld, ist wegen
Gemütsschwäche als entmündigt erklärt und der Handelsmann Simon
Oppenheimer von da als ihr Vormund aufgestellt worden, was man anmit zur
öffentlichen Kenntnis bringt. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 27. April 1844 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Wiesloch.
[Mundtoterklärung]. Bräunle Hochstätter, Tochter des
verstorbenen Baruch Hochstätter zu Michelfeld, ist wegen
Gemütsschwäche als entmündigt erklärt und der Handelsmann Simon
Oppenheimer von da als ihr Vormund aufgestellt worden, was man anmit zur
öffentlichen Kenntnis bringt.
Wiesloch, den 21. April 1844.
Großherzogliches Bezirksamt." |
Moses Menges ist ohne Erlaubnis nach Amerika
ausgewandert (1853)
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 18- Juni 1853 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Sinsheim
[Aufforderung.] Der Soldat vom 4. Infanterie-Regiment Moses Menges von
Michelfeld, hat sich heimlicher Weise von Hause entfernt und
wahrscheinlich nach Amerika begeben. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 18- Juni 1853 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Sinsheim
[Aufforderung.] Der Soldat vom 4. Infanterie-Regiment Moses Menges von
Michelfeld, hat sich heimlicher Weise von Hause entfernt und
wahrscheinlich nach Amerika begeben.
Derselbe wird daher auffordert, sich binnen 2 Monaten dahier oder
bei seinem Kommando zu stellen, widrigenfalls er, vorbehaltlich seiner
persönlichen Bestrafung im Betretungsfalle, wegen Desertion in eine
Geldstrafe von 1200 fl. verfällt werden würde,
Sinsheim, den 7. uni 1853." |
Über Zacharias Oppenheimer (1830-1904)
Zur Geschichte des Betsaals / der Synagoge
Zunächst bestand vermutlich ein Betsaal.
Noch im 18. Jahrhundert dürfte ein Synagoge erbaut worden sein. Ende der
1820er-Jahre war das Gebäude zu klein geworden. Der damalige Gemeindevorsteher
Simon Oppenheimer schrieb am 19. Mai 1829 an das Bezirksamt Sinsheim, dass durch
die Zunahme der Gemeindemitglieder auf inzwischen 120 bis 130 Personen die
Synagoge zu klein und inzwischen auch in baufälligem Zustand sei. Er habe
mehrere Baupläne und Kostenüberschläge fertigen lassen. Die Gemeinde habe
einstimmig eine Vergrößerung des Synagoge bei einem Kostenaufwand von 900 bis
1000 Gulden beschlossen und bitte das Bezirksamt um Genehmigung. Das Bezirksamt
ließ die Pläne prüfen. Vom Direktorium des Neckarkreises kam am 14. September
1830 die Baugenehmigung. Inzwischen hatte Simon Oppenheimer mit der Gemeinde
auch einen Finanzierungsplan abgesprochen. Demnach hatte die Gemeinde auf einem
Konto 400 Gulden angespart, 142 Gulden waren in der Kasse vorhanden, der
Restbetrag von 400 bis 500 Gulden sollte durch wöchentliche Beiträge der
Familienvorstände in Höhe von 2 Gulden gesammelt werden. Bevor der Bau der
Synagoge begann, wurde von einem Wieslocher Werkmeister ein Gutachten des
Synagogenbaus im Blick auf den Umbau erstellt. Dabei stellte er fest, dass die
Synagoge in einem "zerrüttetem und nicht gut zu verbesserndem Zustande sei"
und "die alte Synagoge weggeschafft und eine neue dafür erbaut werde".
Vermutlich wurden auf Grund dieses Gutachtens die Baupläne nochmals neu überdacht
und 1838 eine neue Synagoge in der Schallbachgasse ("Judengässel")
erstellt. Es handelte sich um ein Gebäude mit Betsaal, Lehrerwohnung und
Schulzimmer, in dem bis 1876 auch der Schulunterricht der Kinder stattfand,
danach - bis um 1920 - noch der Religionsunterricht der Kinder.
Mitte der 1920er-Jahre konnten bereits keine Gottesdienste
in der Synagoge gefeiert werden, da keine zehn jüdische Männer mehr am Ort
wohnten. Die jüdische Gemeinde vermietete daher den Betsaal an die politische
Gemeinde zu einem jährlichen Mietpreis von 90 RM. Als sich nach 1933 die
Beziehung zwischen politischer und jüdischer Gemeinde schnell verschlechterte,
stellte die politische Gemeinde 1935 und 1936 die Zahlung der Miete für den
Betsaal ein. Erst auf Grund mehrerer Mahnungen des Oberrates der Israeliten
wurde die Miete überwiesen, aber zugleich das Mietverhältnis vom Bürgermeister
zum 1. Januar 1937 beendet. Die politische Gemeinde stellte ihrerseits Überlegungen
zur künftigen Nutzung der Synagoge an. Im Januar 1936 stand die freiwillige
Sanitätskolonne in Michelfeld mit dem Oberrat der Israeliten dazu in
Verhandlungen. Freilich war das Gebäude inzwischen in höchst baufälligem
Zustand. Der Bezirksbaumeister stellte bei seiner Bestandsaufnahme im Februar
1936 fest, dass die Außen- und Innenwände völlig durchfeuchtet waren. Außerdem
waren der Dachstuhl teilweise eingedrückt, der Decken- und Wandverputz in
mehreren Räumen abgefallen, die Holzböden in der Wohnung im ersten Stock
angefault und die Steinböden in Keller und Decke in sehr schlechtem Zustand.
Auch die Ziegeldeckung, Dachgesimse und Kamine hätten dringend eine Reparatur nötig.
Der Bezirksbaumeister schloss seinen Bericht mit der Bemerkung: "Eine gründliche
Instandsetzung würde sehr viel Geld kosten und würde von niemand durchgeführt
werden können' und schätzte das Gebäude mit Grundstück gerade noch auf
einen Wert von 1.500 RM ein. Inzwischen hatte der Oberrat der Israeliten
Ferdinand Strauss mit der Wahrnehmung der Interessen der ehemaligen jüdischen
Gemeinde beauftragt. Strauss bat beim Bürgermeister im September 1936 darum,
die Synagogenbänke öffentlich versteigern zu dürfen, was der Bürgermeister
jedoch mit der Begründung ablehnte, dass "es mit der heutigen Zeit
unvereinbar ist, die Interessen der jüdischen Rasse oder Religionsgemeinschaft
zu vertreten". Strauss konnte die Bänke wenig später allerdings auch ohne
Versteigerungstermin verkaufen. Da auf Grund des schlechten Bauzustandes der
Synagoge an keine andere Verwendung mehr zu denken war, wurde das Gebäude am
20. Dezember 1936 an den Gewerbefortbildungsschullehrer Ernst Henny aus
Adelsheim verkauft. Er wollte das Gebäude abbrechen und das Grundstück als
Garten nützen.
Heute befindet sich auf dem Synagogengrundstück ein
Garten. Spuren oder eine Gedenktafel sind nicht vorhanden.
Fotos
Historische Darstellung:
|

|
Zeichnung der ehemaligen
Synagoge in Michelfeld
(Quelle: hier
anklicken - Zeichnung von Richard Weigel, Angelbachtal) |
| |
|
Pläne:
 |
 |
Plan von Michelfeld 1870 aus:
Johann Jenne, Michelfeld
s. Lit. S. 187; die Eintragung der Synagoge mit
einem "S" von Hahn |
In obigem Plan von Michelfeld mit einem roten Kreis markiert:
der Standort der
ehemaligen Synagoge in der
Schallbachgasse ("Judengässel") (topographischer Plan aus den
1970er-Jahren) |
Fotos nach 1945/Gegenwart:
Fotos um 1985:
(Fotos: Hahn) |
 |
 |
| |
Straßenschild für die "Schallbachgasse",
auch
"Judengässel" genannt. |
Im Bereich dieser Gärten in der
Schallbachgasse war der
Standort
der ehemaligen Synagoge |
| |
| |
|
|
| Neuere Fotos |
Neuere Fotos des Synagogengrundstückes werden
bei Gelegenheit erstellt; über Zusendungen freut sich der Webmaster von
"Alemannia Judaica", Adresse siehe Eingangsseite |
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
|
März 2020:
Buch von Leonhard Dörfer zur
jüdischen Geschichte in Michelfeld erschienen
|
Artikel
in der Website der Gemeinde Angelbachtal vom 26. Mai 2020:
"Buch 'Jüdisches Leben in Michelfeld' erschienen
Gemeinde gibt zweites Werk von Leonhard Dörfer zur israelitischen Geschichte
heraus
Angelbachtal. (abc) Mit 'Jüdisches Leben in Michelfeld' gibt die
Gemeinde dieser Tage ein weiteres Werk zur Ortsgeschichte heraus. Nachdem
der Autor Leonhard Dörfer schon einen Band über 'Jüdisches Leben in
Eichtersheim' veröffentlicht hat, beschreibt der seit Jahrzehnten vor Ort
verwurzelte, engagierte Historiker nun die über 200-jährige Geschichte des
Michelfelder Pendants. Nach den verheerenden Verlusten an Menschen und
Wohnräumen zweier Kriege des 17. Jahrhunderts beteiligten sich die jüdischen
Mitbürger aktiv am Wiederaufbau des Ortes.
Mit 242 Personen – 20% der damaligen Einwohnerschaft – hatte die jüdische
Gemeinde 1848 ihren Höhepunkt erreicht und war damit eine der größten
jüdischen Landgemeinden in Baden. Heute ist der Judenfriedhof der einzige
sichtbare Beweis für die Existenz einer israelitischen Gemeinde; sie wurde
im November 1935 durch staatlichen Beschluss aufgelöst, nachdem sie zuvor
schon immer kleiner geworden war.
Dörfers Leistung ist umso höher zu bewerten, da der mittlerweile 88jährige
Autor in jüngster Zeit nur noch eingeschränkt mobil war. Trotzdem kann er
sich noch gut an den Anfang des Projektes erinnern: 'Im September 2016 bin
ich auf dem jüdischen Friedhof in Michelfeld Ruth Danon aus Israel begegnet,
die dort das Grab ihres Großvaters besucht hatte. Aus ihren Erzählungen
erkannte ich, dass ich fast nichts vom jüdischen Leben in Michelfeld wusste.
Und das hat mich angeregt, dieses Buch zu verfassen', so Dörfer. Schon
damals war es dem pensionierten Pädagogen nicht mehr möglich gewesen, vor
Ort im Generallandesarchiv zu recherchieren. Von früheren Besuchen hatte
Dörfer aber einiges an Material mitgebracht, das ihm als Grundstock für das
neue Werk diente. 'Dank der großen Hilfe von Diethelm Brecht ist es
gelungen, die Arbeit zu Ende zu führen', lobte er die hervorragende
Zusammenarbeit mit dem Hauptamtsleiter der Gemeinde, der ihn maßgeblich bei
der Fertigstellung unterstützt hatte.
Bürgermeister Frank Werner ist dankbar für die umfangreiche Aufarbeitung der
jüdischen Geschichte: 'Ihnen ist es zu verdanken, dass wir die
Erinnerungskultur in einer Weise pflegen können, wie es in vielen anderen
Gemeinden nicht möglich ist.' Er bedauere es außerordentlich, dass eine
offizielle Buchvorstellung in diesen Zeiten nicht möglich sei. Selbst ein
gemeinsames Pressefoto könne nicht gefertigt werden, ohne den Autor einem
gesundheitlichen Risiko auszusetzen. Aber trotzdem sei es wichtig, der
Bevölkerung dieses wichtige Werk nicht vorzuenthalten. Er bedankte sich bei
Norbert Hinzmann für die ergänzende Unterstützung des Heimatvereins zur
Herausgabe des Buchs.
Der bebilderte, von Jens Neckermann ansprechend gestaltete Band dokumentiert
das Leben und Wirken dieser jüdischen Gemeinde und schildert plastisch das
Zusammenleben der verschiedenen Konfessionen in einem ländlichen Dorf.
Schwerpunkte sind unter anderem die israelitische Schule, eine
Bestandserhebung der Häuser der jüdischen Familien, das Wirtschaftswesen und
bedeutende Persönlichkeiten, aber auch die Opfer der NS-Zeit sowie die
jüdischen Auswanderer und der heutige Kontakt mit deren Nachfahren. Eine
detaillierte Namensliste, ein Auszug aus dem Michelfelder Ortsfamilienbuch
und eine Belegungsliste des jüdischen Friedhofs machen den Band zusätzlich
zu einer wichtigen Quelle für alle ortsgeschichtlich interessierten
Leserinnen und Leser.
'Jüdisches Leben in Michelfeld' ist im verlag regionalkultur (Ubstadt-Weiher)
erschienen und umfasst 120 Seiten mit 50 teils farbigen Abbildungen, die von
einem fester Einband mit Fadenheftung zusammengehalten werden. Für 14,90
Euro pro Exemplar ist es ab sofort bei 'Blumen am Schloss' (Friedrichstraße
3/1), im Bürgerbüro des Rathauses (nach Voranmeldung unter Tel.
07265/912020) oder im Online-Bücher-Shop der Gemeinde erhältlich:
buechershop@angelbachtal.de."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.
1968. S. 201-202. |
 | "Die jüdische Gemeinde in Michelfeld" und "Die Tuchfabrik
Oppenheimer", in: Heimatbuch Michelfeld. 1986. |
 | Johann Jenne: Michelfeld. Das Dorf und seine Geschichte. Hg. von
der Gemeinde Angelbachtal. 1990. 1994². Darin: Die jüdische Gemeinde in
Michelfeld S. 105-106. |
 | Joseph Walk (Hrsg.): Württemberg - Hohenzollern -
Baden. Reihe: Pinkas Hakehillot. Encyclopedia of Jewish Communities from
their foundation till after the Holocaust (hebräisch). Yad Vashem Jerusalem
1986. S. 402-403. |
 |  Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. |
 |
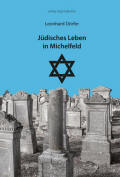 Leonhard Dörfer: Jüdisches Leben in Michelfeld. Hrsg. von der
Gemeinde Angelbachtal. 120 S. mit 50, z.T. farbigen Abb., fester Einband.
ISBN 978-3-95505-206-5. EUR 14,90. Erschienen im Verlag Regionalkultur vgl.
https://verlag-regionalkultur.de/buecher/juedische-geschichte/1191/juedisches-leben-in-michelfeld
Leonhard Dörfer: Jüdisches Leben in Michelfeld. Hrsg. von der
Gemeinde Angelbachtal. 120 S. mit 50, z.T. farbigen Abb., fester Einband.
ISBN 978-3-95505-206-5. EUR 14,90. Erschienen im Verlag Regionalkultur vgl.
https://verlag-regionalkultur.de/buecher/juedische-geschichte/1191/juedisches-leben-in-michelfeld
Erhältlich über die Gemeinde Angelbachtal
buechershop@angelbachtal.de
|
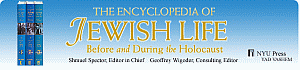
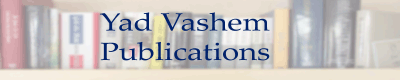
Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Michelfeld Baden. A
community existed from the late 16th century, reaching a peak population of 242
in 1841 and operating a synagogue, cemetery, and elementary school. The two
Jewish families present in 1933 dispersed in the Nazi era.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|